Anlaufwiderstände
In Übereinstimmung mit Widerstandsbelegung Rheostate werden in Starten, Starten, Regeln, Regeln, Laden und Erregen unterteilt.
Anlaufrheostaten und der Anlaufteil des Anlaufrheostaten müssen zur Reduzierung der Größe eine große Zeitkonstante haben. Diese Rheostate sind ausgelegt für kurzfristigen Betriebund die Anforderungen an eine erhöhte Widerstandsstabilität werden ihnen nicht auferlegt. Gemäß den geltenden Normen heizt sich der Startwiderstand nach drei Starts mit Intervallen zwischen den Starts, die dem Doppelten der Startzeit entsprechen, auf die maximale Temperatur auf.
Alle anderen Rheostate unterliegen Widerstandsanforderungen und sind für den Langzeitbetrieb ausgelegt. Im Elektroantrieb sind Rheostaten mit schaltbaren Metallwiderständen die gebräuchlichsten. Sie werden zum Schalten verwendet Flach-, Trommel- und Nockensteuerungen (bei hohen Leistungen).
Je nach Art des Kühlers können Rheostaten natürlich luft- oder ölgekühlt, zwangsluft-, öl- oder wassergekühlt sein.

Natürliches Design mit luftgekühltem Rheostat
Bei natürlich luftgekühlten Rheostaten sind das Schaltgerät und die Widerstände so angeordnet, dass konvektive Luftströme, die sich von unten nach oben bewegen, die Widerstände kühlen. Die Abdeckungen des Rheostaten dürfen die Zirkulation der Kühlluft nicht behindern. Die maximale Gehäusetemperatur darf 160 °C nicht überschreiten. Die Temperatur der Kontakte des Schaltgerätes darf 110 °C nicht überschreiten.
In solchen Rheostaten werden alle Arten von Widerständen verwendet. Bei geringer Leistung sind die Widerstände und der Regler in einem Gerät zusammengefasst. Bei hoher Kapazität ist der Controller ein eigenständiges Gerät.
Rheostate der RP- und RZP-Serie dienen zum Starten von Gleichstrommotoren mit Nebenschluss und kombinierter Erregung mit einer Leistung von bis zu 42 kW. Diese Rheostate enthalten neben den Widerständen und dem Regler ein zusätzliches Schütz zum Unterspannungsschutz und ein Maximumrelais zum Überstromschutz.
Widerstände werden auf Porzellanrahmen oder als Rahmenelemente gefertigt. Das Schaltgerät ist als Flachregler mit selbstausrichtendem Brückenkontakt ausgeführt. Der Regler, das Kleinschütz KM und das Maximalstromrelais KA sind auf einem gemeinsamen Panel installiert. Die Rheostatblöcke sind auf einem Stahlsockel montiert. Das Gehäuse schützt den Rheostat vor Wassertropfen, behindert jedoch nicht den freien Luftstrom.
Der Stromkreis zum Einschalten eines dieser Rheostattypen ist in der Abbildung dargestellt. Beim Anlassen des Motors wird die Nebenerregerspule Ш1, Ш2 an das Netz angeschlossen und in den Anker ein Anlaufwiderstand eingebracht, dessen Widerstand mit Hilfe des Reglers mit zunehmender Motordrehzahl abnimmt.Der bewegliche Brückenkontakt 16 schließt die festen Kontakte 0 - 13 mit den Stromsammelschienen 14, 15, die mit den Wicklungskreisen des Motors verbunden sind.
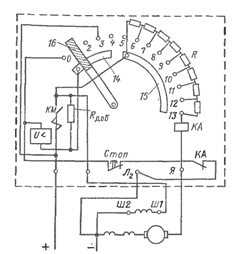
Schaltkreis des Anlaufwiderstands
In der Stellung 0 des Kontakts 16 wird die Spule des Schützes KM kurzgeschlossen, das Schütz ausgeschaltet und der Motor abgestellt. In Stellung 3 liegt die Versorgungsspannung an der Spule des KM, das Schütz schaltet und schließt seine Kontakte. In diesem Fall wird die volle Spannung an die Erregerspule angelegt und alle Rheostat-Startwiderstände werden in den Ankerkreis einbezogen.
In Stellung 13 ist der Anlaufwiderstand vollständig zurückgenommen. In der Position 5 des beweglichen Kontakts 16 wird die Spule des Schützes KM über den Widerstand Radd und den geschlossenen Kontakt KM mit Strom versorgt. Gleichzeitig sinkt die vom CM aufgenommene Leistung und die Auslösespannung steigt. Bei einem Spannungsabfall von 20 – 25 % unter den Nennwert fällt das Schütz KM ab und trennt den Motor vom Netz und schützt so vor einem unzulässigen Abfall der Motorspannung.
Bei einem Überstrom der Motorüberlastung (1,5 — 3) Aznom wird das Maximalrelais von KA aktiviert, das den Stromkreis der Spule KM unterbricht. In diesem Fall schaltet das KM-Schütz ab und deaktiviert den Motor. Nach dem Ausschalten des Motors schließen die KA-Kontakte wieder, das KM-Schütz schaltet jedoch nicht ein, da nach dem Ausschalten des KM der Stromkreis seiner Spule offen bleibt. Zum Neustart ist es notwendig, den Kontakt 16 des Reglers in Position 0 oder zumindest in die zweite Position zu bringen.
Zum Abschalten des Motors wird der Kontakt 16 auf 0 gesetzt. Sinkt die Netzspannung auf die Freigabespannung des Schützes, verschwindet dessen Anker und der Motor wird vom Netz getrennt.Dadurch wird ein minimaler Motorschutz erreicht. Die Pins 1, 2, 4 und 5 werden nicht verwendet, wodurch verhindert wird, dass der Controller zwischen Hochstrom-Pins einen Lichtbogen erzeugt. Das beschriebene Schema ermöglicht die Fernabschaltung des Motors über die Stopp-Taste mit Öffnerkontakt.
Über die Auswahl eines Start-Rheostaten muss ich Bescheid wissen Leistung eines Elektromotors, die Startbedingungen und die Art der Last ändern sich während des Startvorgangs, ebenso wie die Versorgungsspannung des Motors.

Öl-Rheostaten
Bei Öl-Rheostaten befinden sich die Metallelemente der Widerstände und des Reglers im Inneren Transformatoröl, das eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität als Luft aufweist. Dadurch kann das Öl die Wärme effizienter von den erhitzten Metallteilen übertragen. Aufgrund der großen Ölmenge bei der Erwärmung erhöht sich die Aufheizzeit des Rheostaten stark, wodurch Anlaufrheostaten mit kleinen Abmessungen für hohe Lastleistungen realisiert werden können.
Um eine lokale Überhitzung von Widerständen zu verhindern und deren thermischen Kontakt mit Öl zu verbessern, werden in Rheostaten Widerstände in Form einer freien Spirale, Draht- und Bandfelder im Zickzack aus Elektroband und Gusseisen verwendet.
Bei Temperaturen unter 0 °C verschlechtert sich die Kühlfähigkeit des Öls aufgrund einer Erhöhung seiner Viskosität stark. Daher werden Öl-Rheostaten nicht bei negativen Umgebungstemperaturen eingesetzt. Die Kühlfläche des Öl-Rheostaten wird durch die im Allgemeinen zylindrische Oberfläche des Gehäuses bestimmt.Diese Fläche ist kleiner als die Kühlfläche des Widerstandsdrahtes; Daher ist der Einsatz von Öl-Rheostaten im Langzeitbetrieb unpraktisch. Die niedrige zulässige Heiztemperatur des Öls begrenzt auch die Leistung, die der Rheostat abführen kann.
Nach dreimaligem Starten des Motors muss der Anlaufwiderstand auf Umgebungstemperatur abkühlen. Da dieser Vorgang etwa 1 Stunde dauert, werden bei seltenen Starts Öl-Start-Rheostaten verwendet.
Das Vorhandensein von Öl verringert den Reibungskoeffizienten zwischen den Kontakten des Schaltreglers drastisch. Dies reduziert den Verschleiß der Kontakte und das erforderliche Drehmoment am Steuergriff.
Die geringen Reibungskräfte ermöglichen es, den Kontaktdruck um das 3- bis 4-fache zu erhöhen und so die Strombelastung der Kontakte zu erhöhen. Dadurch ist es möglich, die Größe des Schaltgeräts und des gesamten Rheostaten insgesamt drastisch zu reduzieren. Darüber hinaus verbessert das Vorhandensein von Öl die Bedingungen zum Löschen des Lichtbogens zwischen den Kontakten des Schaltgeräts. Allerdings spielt das Öl auch eine negative Rolle bei der Funktion der Kontakte. Ölabbauprodukte, die sich auf der Kontaktfläche absetzen, nehmen zu Übergangswiderstand und damit die Temperatur der Kontakte selbst. Dadurch wird der Ölzersetzungsprozess intensiver.
Die Kontakte sind so ausgelegt, dass ihre Temperatur 125 °C nicht überschreitet. Ölzersetzungsprodukte lagern sich auf der Oberfläche der Widerstände ab und verschlechtern den thermischen Kontakt der Drähte mit dem Öl. Daher darf die maximal zulässige Temperatur des Transformatoröls 115 °C nicht überschreiten.
Öl-Rheostaten werden häufig für den Dreiphasenanlauf verwendet Asynchronläufermotoren… Für Motorleistungen bis 50 kW kommen Flachregler mit kreisförmiger Bewegung des beweglichen Kontakts zum Einsatz. Bei hohen Leistungen kommt ein Drum-Controller zum Einsatz.
Rheostate können über Sperrkontakte verfügen, um den Zustand des Geräts zu signalisieren und zu blockieren Schütz im Statorwicklungskreis des Motors. Wenn der maximale Widerstand des Rheostaten noch nicht erreicht ist, ist die Wicklung des Einschaltschützes offen und es wird keine Spannung an die Statorwicklung angelegt.
Am Ende des Starts des Elektromotors sollte der Rheostat vollständig herausgezogen und der Rotor kurzgeschlossen werden, da die Elemente für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt sind. Je größer die Leistung des Motors ist, desto länger ist die Beschleunigungszeit und desto mehr Stufen muss der Rheostat haben.
Um einen Rheostat auszuwählen, müssen Sie die Nennleistung des Motors, die Spannung des blockierten Rotors bei der Nennspannung des Stators, den Nennstrom des Rotors und das Lastniveau des Motors beim Start kennen. Anhand dieser Parameter können Sie anhand der Nachschlagewerke den Start-Rheostat auswählen.
Nachteile des Öl-Rheostaten: geringe zulässige Starthäufigkeit aufgrund langsamer Abkühlung des Öls, Verschmutzung des Raumes durch Spritzer und Öldämpfe, Möglichkeit der Ölentzündung.
