Was Sie über einen Elektromotor erfahren können, wenn Sie dessen Katalogdaten kennen
Die Asynchronmotorenkataloge enthalten alle für die Motorauswahl notwendigen Daten.
In den Katalogen sind angegeben: Motorgröße, Nennleistung für S1-Modus (Dauerbetrieb), Drehzahl bei Nennleistung, Statorstrom bei Nennleistung, Wirkungsgrad bei Nennleistung, Leistungsfaktor bei Nennleistung, Anlaufstromfrequenz, d. h. is. Anlaufstrom auf die Nenn- oder Vielfache der Anlaufleistung, d.h. das Verhältnis der Gesamtstartleistung zur Nennleistung, das Vielfache des anfänglichen Startdrehmoments, das Vielfache des Mindestdrehmoments, das dynamische Trägheitsmoment des Rotors.
Zusätzlich zu diesen Daten, die sich auf den Nenn- oder Anlaufmodus beziehen, bieten die Kataloge detailliertere Daten über die Änderung des Wirkungsgrads und des Leistungsfaktors bei Änderung der Motorwellenlast. Diese Daten werden in tabellarischer oder grafischer Form dargestellt.Anhand dieser Daten ist es auch möglich, den Statorstrom und den Schlupf bei unterschiedlichen Wellenbelastungen zu berechnen.
In den Katalogen sind auch die notwendigen Maße für die Montage des Motors vor Ort und den Anschluss an das Stromnetz angegeben.

Die verschiedenen Phasen der Motorenentwicklung, des Vertriebs, der Installation, des Betriebs und der Reparatur erfordern unterschiedliche Detaillierungsgrade. Für die meisten Zwecke sind Details auf Größenebene ausreichend. Die Standardgrößenkatalogbeschreibung der Motoren der Serien 4A und AI enthält Merkmale, die mit maximal 24 Zeichen gekennzeichnet sind.
Beispiele. 4A160M4UZ – Induktionsmotor der Serie 4A, mit Schutzart IP44, das Bett und die Schilde sind aus Gusseisen, die Höhe der Drehachse beträgt 160 mm, es besteht aus einem Bett mittlerer Länge M, vierpolig, bestimmt für Arbeiten in gemäßigtem Klima, Kategorie 3.
4АА56В4СХУ1 – Asynchronmotor der 4A-Serie mit Schutzart IP44, Rahmen und Abschirmungen sind aus Aluminium, die Höhe der Drehachse beträgt 56 mm, er hat einen langen Kern, vierpolig, landwirtschaftliche Modifikation entsprechend den Umgebungsbedingungen, vorgesehen für den Betrieb in gemäßigtem Klima, Kategorie 1 pro Platzierung.
Die Nennleistung des Motors ist die mechanische Leistung der Welle in der Betriebsart, für die sie vom Hersteller vorgesehen ist.
Anzahl der Nennleistungen der Elektromotoren: 0,06; 0,09; 0,12; 0,18; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3,7; 5,5; 7,5; elf; 15; 18,5; 22; dreißig; 37; 45; 55; 75; 90; 110; 132; 160; 200; 250; 315; 400 kW.
Die maximal zulässige Motorleistung kann sich bei Änderungen der Betriebsart, der Kühlmitteltemperatur und der Höhe ändern.
Die Motoren müssen ihre Nennleistung beibehalten, wenn die Netzspannung bei der Nennnetzfrequenz um ± 5 % vom Nennwert abweicht und wenn die Netzfrequenz bei der Nennspannung um ± 2,5 % abweicht. Bei gleichzeitiger Abweichung der Netzspannung und -frequenz von den Nennwerten müssen die Motoren ihre Nennleistung beibehalten, wenn die Summe der absoluten Abweichungen 6 % nicht überschreitet und jede der Abweichungen die Norm nicht überschreitet.
Synchronmotorgeschwindigkeit
Eine Reihe synchroner Drehzahlen von Asynchronmotoren werden von GOST festgelegt und bei einer Netzfrequenz von 50 Hz gibt es folgende Werte: 500, 600, 750, 1000, 1500 und 3000 U/min.
Dynamisches Trägheitsmoment des Rotors des Elektromotors
Das Maß für die Trägheit eines Körpers während der Rotationsbewegung ist das Trägheitsmoment, gleich der Summe der Produkte der Massen aller Punktelemente mit dem Quadrat ihrer Abstände von der Rotationsachse. Das Trägheitsmoment des Rotors des Induktionsmotors ist gleich der Summe der Trägheitsmomente der mehrstufigen Welle, des Kerns, der Wicklung, des Lüfters, des Keils, der rotierenden Teile von Wälzlagern, der Spulenhalter und der Anlaufscheiben des Phasenrotors usw.
Die Befestigung von Elektromotoren am Objekt erfolgt mittels Füßen, Flanschen oder Füßen und Flanschen zugleich.
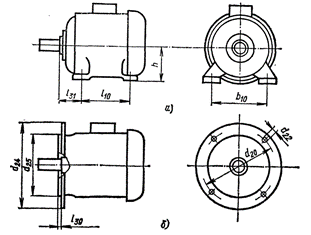
Einbaumaße von Asynchron-Elektromotoren mit Kurzschlussläufer der Lampen (a) und mit Flansch (b)
Am Bein montierte Elektromotoren haben vier Hauptmontagegrößen:
h (H) – Abstand von der Achse der Welle zur Auflagefläche der Beine (Grundgröße),
b10 (A) – Abstand zwischen den Achsen der Befestigungslöcher,
l10 (B) – Abstand zwischen den Achsen der Befestigungslöcher (Seitenansicht),
l31 (C) – Abstand vom tragenden Ende des freien Endes der Welle bis zur Achse der nächstgelegenen Befestigungslöcher in den Beinen.
Elektromotoren mit Flanschen haben vier Hauptmontagegrößen:
d (M) – Durchmesser des Kreises der Mittelpunkte der Befestigungslöcher,
d25 (N) – Durchmesser der Schärfzentrierung,
d24 (P) – Außendurchmesser des Flansches,
l39 (R) ist der Abstand von der Auflagefläche des Flansches zur Auflagefläche des Endes der freien Welle.
Eigenschaften von Elektromotoren
Mechanische Eigenschaften und Starteigenschaften des Motors
Die mechanische Eigenschaft ist die Abhängigkeit des Motordrehmoments von seiner Drehzahl bei konstanter Spannung, Netzfrequenz und externen Widerständen in den Motorwicklungskreisen.
Die Anlaufeigenschaften werden durch die Werte Anlaufmoment Mp, Mindestdrehmoment Mmin, maximales (kritisches) Moment Mcr, Anlaufstrom Azp oder Anlaufleistung Pp bzw. deren Vielfache charakterisiert. Die Abhängigkeit des vom Nennschlupfmoment angegebenen Moments wird als relative mechanische Kennlinie des Elektromotors bezeichnet.
Das Nenndrehmoment des Elektromotors, N/m, wird durch die Formel bestimmt
Mnom = 9550 (Rnom / nnom)
wo Rnom – Nennleistung, kW; nnom – Nenngeschwindigkeit, U/min.
Die Vielfalt der mechanischen Eigenschaften für verschiedene Modifikationen von Induktionsmotoren ist in der Abbildung dargestellt.
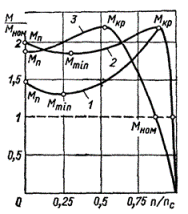
Mechanische Eigenschaften von Asynchron-Elektromotoren mit Käfigläufer: 1 – Basisradar, 2 – mit erhöhtem Anlaufdrehmoment, 3 – mit erhöhtem Schlupf.
Die mechanischen Eigenschaften einer Gruppe von Motoren, die ein Segment der Serie darstellen, passen in eine bestimmte Zone.Die Mittellinie dieser Zone wird als gruppenmechanische Charakteristik des Seriensegments bezeichnet. Die Breite des Gruppenkennlinienbereichs überschreitet nicht das Momententoleranzfeld.
Leistungsmerkmale von Elektromotoren
Die Leistungsmerkmale sind die Abhängigkeiten von Eingangsleistung P1, Strom in der Statorwicklung Az, Drehmoment M, Wirkungsgrad, Leistungsfaktor cos f und Schlupf s von der Nettoleistung des Motors P2 bei konstanter Spannung an den Klemmen der Statorwicklung, die Frequenz des Netzwerks und die externen Widerstände in den Motorwicklungskreisen. Fehlen solche Abhängigkeiten, so lassen sich aus den Zahlen näherungsweise die Werte für Wirkungsgrad und cos f ermitteln.
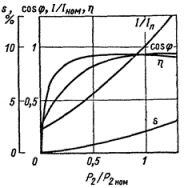
Eigenschaften von Asynchronmotoren
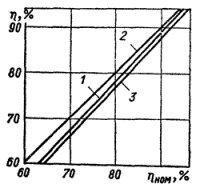
Wirkungsgrad des Elektromotors bei Teillast: 1 — P2 / P2nom = 0,5, 2 — P2 / P2nom = 0,75, 3 — P2 / P2nom = 1,25
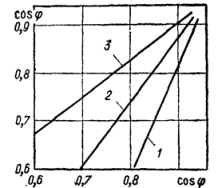
Leistungsfaktor des Elektromotors bei Teillast: 1 — P2 / P2nom = 0,5, 2 — P2 / P2nom = 0,75, 3 — P2 / P2nom = 1,25
Der verschiebbare Elektromotor kann ungefähr durch die Formel bestimmt werden:
snom = s2 (P2 / Pnom),
und Strom auf der Statorleitung eines Elektromotors – nach der Formel:
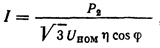
wobei I – Statorstrom, A, cos f – Leistungsfaktor, Unominal – Nennnetzspannung, V.
Motorrotorgeschwindigkeit:
n = nc (1 — s),
wobei nc die synchrone Drehzahl des Elektromotors in U/min ist.
Bau von Elektromotoren
Schutzart Elektromotoren
Der Schutzgrad von Elektromotoren ist in GOST 17494-72 definiert. Die Merkmale des Schutzgrades und ihre Bezeichnungen sind in GOST 14254-80 definiert.Diese Norm legt den Schutzgrad des Personals gegen den Kontakt mit spannungsführenden oder beweglichen Teilen in Elektromotoren sowie gegen das Eindringen fester Fremdkörper und Wasser in Elektromotoren fest.
Der Schutzgrad wird durch zwei lateinische Buchstaben IP (International Protection) und zwei Zahlen angegeben. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad des Personals vor Kontakt mit beweglichen oder spannungsführenden Teilen sowie den Schutzgrad gegen das Eindringen fester Fremdkörper in Elektromotoren an. Die zweite Ziffer gibt den Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser in die Elektromotoren an
Methoden zur Kühlung von Elektromotoren
Kühlmethoden werden durch zwei lateinische Buchstaben 1C (International Cooling) und eine Charakteristik des Kühlkreislaufs gekennzeichnet.
Jeder Kühlkreislauf eines Elektromotors weist eine Charakteristik auf, die durch einen lateinischen Buchstaben, der die Art des Kältemittels angibt, und zwei Zahlen gekennzeichnet ist. Die erste Zahl gibt die Gestaltung des Kreislaufs für die Kältemittelzirkulation an, die zweite die Art der Energiebereitstellung für die Kältemittelzirkulation. Verfügt der Elektromotor über zwei oder mehr Kühlkreisläufe, so zeigt die Bezeichnung die Eigenschaften aller Kühlkreisläufe. Wenn Luft das einzige Kältemittel für den Elektromotor ist, kann der Buchstabe, der die Art des Gases angibt, weggelassen werden.
Bei Asynchronmotoren kommen folgende Kühlmethoden zum Einsatz: IC01 – Motoren mit den Schutzarten IP20, IP22, IP23 mit einem auf der Motorwelle angebrachten Lüfter, IC05 – Motoren mit den Schutzarten IP20, IP22, IP23 mit angebautem Lüfter mit unabhängigem Antrieb, IC0041 – Motoren mit den Schutzarten IP43, IP44, IP54 mit natürlicher Kühlung; IC0141 – Motoren mit den Schutzarten IP43, IP44, IP54 mit einem externen Lüfter auf der Motorwelle, IC0541 – Motoren mit den Schutzarten IP43, IP44, IP54 mit einem angebauten Lüfter mit unabhängigem Antrieb.
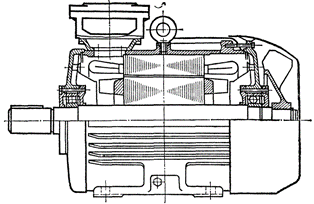
Geschlossener Motor (Schutzart IP44)
Hitzebeständigkeitsklassen des Isolationssystems des Elektromotors
Isoliermaterialien für Elektromotoren werden nach ihrer Hitzebeständigkeit in Klassen eingeteilt.
Abhängig von der maximal zulässigen Temperatur wird das Isoliermaterial in die eine oder andere Klasse eingeteilt. Motoren arbeiten bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen.
 Als Nennumgebungstemperatur für gemäßigte Klimazonen wird, sofern nicht anders angegeben, eine Temperatur von 40 °C angenommen. Die maximal zulässige Temperaturerhöhung der Motorwicklung ergibt sich durch Subtraktion von 40 vom Temperaturindex des Isolationssystems.
Als Nennumgebungstemperatur für gemäßigte Klimazonen wird, sofern nicht anders angegeben, eine Temperatur von 40 °C angenommen. Die maximal zulässige Temperaturerhöhung der Motorwicklung ergibt sich durch Subtraktion von 40 vom Temperaturindex des Isolationssystems.
Bei der Wahl einer höheren Hitzebeständigkeitsklasse (z. B. F statt B) können zwei Auswahlziele erreicht werden:
1) Erhöhung der Motorleistung bei konstanter theoretischer Lebensdauer,
2) Erhöhung der Lebensdauer und Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung. In den meisten Fällen soll der Einsatz einer hitzebeständigeren Isolierung die Zuverlässigkeit des Motors unter schwierigen Betriebsbedingungen verbessern.
